5.8 Schweidnitz/Swidnica
Schweidnitz, eine Stadt mit 60.000 Einwohnern, liegt im fruchtbaren Tal zwischen Zobten- und Eulengebirge, etwa 50 Kilometer südwestlich von Breslau.
Ein Dokument des Franziskanerordens nennt Schweidnitz 1249. Als Stadt wird der Ort erstmals 1267 erwähnt. Ab 1291 war Schweidnitz für ein Jahrhundert Residenz des Herzogtums Schweidnitz-Jauer. Dieses wurde von einer Nebenlinie der schlesischen Piasten regiert. Durch Heirat und Erbfolge kam das Herzogtum an die böhmische Krone, mit der es 1526 (Mohácz) zu Österreich kam, bis die Preußen es 1741 eroberten. 80

Die Reformation kam früh nach Schweidnitz mit Pastor Sebastian Anger 1535. 1544 wurden in zwei, ab 1569 in allen Stadtkirchen evangelische Gottesdienste abgehalten. Im Dreißigjährigen Krieg hatte es der päpstliche Legat Karaffa darauf abgesehen, die schlesischen Erbfürstentümer zu katholisieren. 1629 drangen die Lichtensteiner Dragoner unter Hannibal von Dohna ein und vertrieben die evangelischen Geistlichen. Alle 14 Kirchen wurden den Katholiken übergeben. Die Schweden eroberten 1632 die Stadt, kapitulierten aber 1644, und österreichische Soldaten und Jesuiten kehrten zurück. Hunger und Seuchen forderten 17.000 Opfer, Schweidnitz büßte seine Bedeutung als zweitwichtigste Stadt Schlesiens nach Breslau ein.
Die Stadt kam 1741 an Preußen, 1757 zurück zu Österreich, 1758 wieder zu Preußen, 1761 erneut an Österreich und 1762 endgültig an Preußen. Die neuen Machthaber errichteten vier Forts, derer sich 1807 die Franzosen bemächtigten. Diese schleiften die Außenwerke, welche die Preußen 1816 wieder herstellten. 1868 wurde die Stadt entfestigt und bekam einen Grüngürtel.

Das bedeutendste Bauwerk von Schweidnitz und vielleicht ganz Schlesien ist die Friedenskirche "Zur Heiligen Dreifaltigkeit" (polnisch Kosciól Pokoju pw. Swietej Trójcy). Sie steht mit der von Jauer seit 2001 auf der Weltkulturerbe-Liste der UNESCO.
Zu den Beschlüssen des Westfälischen Friedens von 1648 gehörte die Erlaubnis für die schlesischen Protestanten, drei Kirchen zu bauen in Glogau, Jauer und Schweidnitz. Bedingungen waren:
Standorte außerhalb der Stadtmauern, kein Turm, keine Glocken, als Material Holz ohne Nägel, Lehm, Sand und Stroh; der Bau durfte nicht länger als ein Jahr dauern. Die Schweidnitzer ist die größte der drei Friedenskirchen mit 1.090 Quadratmeter Fläche und etwa 7.500 Plätzen, darunter rund 3.000 Sitzplätze. 81
Die Entwürfe fertigte der Breslauer Architekt Albrecht von Saebisch von 1656 - 58. Er projektierte den Fachwerkbau auf dem Grundriss eines griechischen Kreuzes. Das Langhaus misst 44 mal 20 Meter, das Querhaus 30,50 mal 20 Meter. Vier Meter vor den Wänden stehen Reihen von viereckigen Eichenpfeilern, welche das Dach und den oberen Teil der Wände tragen und außerdem die zweistöckigen Emporen stützen. Die Wände bestehen aus einem Holzskelett aus rechtwinklig, teilweise über Kreuz zusammen gefügten Balken. Die Gefache sind mit Stroh und Lehm ausgefüllt. Das Dach ist mit Schindeln gedeckt.

Die Innenausstattung ist barock. Die Emporen sind in der ganzen Länge mit 78 Bibelsprüchen beschriftet, die von 47 allegorischen Szenen bebildert werden. Über dem Haupteingang ragt halbkreisförmig die verglaste Loge der Familie von Hochberg von 1698 hervor. Dieses Adelshaus hat zwei Drittel des Bauholzes gestiftet.
Die Kanzel von 1729 und den Altar von 1752 schuf Gottfried August Hoffmann. Über der Kanzeltür ist ein Flachrelief mit Jesus als gutem Hirten. Das Treppengeländer zieren drei Reliefs, welche die Ausgießung des Heiligen Geistes, Golgatha und das Paradies darstellen. Die Balustrade umrahmen drei Skulpturen, die Glaube, Hoffnung und Liebe symbolisieren. Den Kanzeldeckel krönt ein Posaune blasender Engel, der das Jüngste Gericht ankündigt.
Über dem Altartisch ist ein Flachrelief mit dem Abendmahl angebracht. Darüber steht eine Skulpturengruppe mit Moses, Aaron, Jesus, Johannes dem Täufer und den Aposteln Petrus und Paulus. Sechs korinthische Säulen tragen einen Fries mit der Aufschrift: "Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe" (Mat. 3,17). Auf der Altarkuppel steht auf dem Buch mit sieben Siegeln das Lamm mit der Fahne (unten links).
Die Decke wurde 1696 mit Szenen aus der Offenbarung bemalt: über dem Altar das Himmlische Jerusalem, über der Orgel das Buch mit den sieben Siegeln, über der Brauthalle das sündige Babel und über der Feldhalle das Jüngste Gericht.

Das Taufbecken von 1661 hat Pankratius Werner aus Hirschberg geschaffen. Der obere Teil trägt eine vergoldete Schnitzerei, welche die Taufe Jesu durch Johannes darstellt. Den unteren Teil zieren sechs Kassetten mit den Wappen der Stifter. An den Wänden der Taufhalle hinter dem Altar hängen 40 Porträts der Prediger aus drei Jahrhunderten.
Die Orgel von 1666 - 69 ist ein Werk von Christoph Klose aus Brieg. Auf beiden Seiten des Spieltisches stützen Athleten die großen Prospektpfeifen. Etwa ein gutes Jahrhundert später wurde die Orgel umgebaut mit beweglichen, musizierenden Engeln und der Kopplung an das Glockenspiel. Wegen häufiger Reparaturen des großen Instruments wurde auf der oberen Empore über dem Altar 1695 eine zweite kleine Orgel aufgestellt.
1708 wurde 50 Meter neben die Kirche ein Glockenturm gebaut. Er enthält drei Glocken. 1714 erhielt die Kirche selbst eine kleine Glocke, die das große Geläut einstimmt und abschließt. 82 Die Evangelisch-Augsburgische Kirchengemeinde zählt nur etwa 50 Mitglieder. Gottesdienste werden in der Friedenskirche auch auf Deutsch gehalten. Touristen können sowohl auf Polnisch als auch auf Deutsch gute Texte vom Tonband anhören.
5.9 Peterswaldau/Pieszyce
Die Kleinstadt mit 9.500 Einwohnern liegt in einem Talkessel in einer Höhe zwischen 260 bis 400 Metern am Nordfuß des Eulengebirges. Peterswaldau entstand als Waldhufendorf zu Beginn des 13. Jh. In einer Urkunde des Bischofs von Breslau wurde es 1248 erstmalig erwähnt. 83


Graf Friedrich von Gellhorn ließ hier 1617 ein imposantes Renaissance-Schloss auf den Fundamenten des Vorgängerbaus von 1580 errichten, das aber seit 1710 eine barocke Fassade trägt. Das Anwesen ging auf Graf Erdmann von Promnitz über, der das Schloss 1765 seinem Enkel Graf Christian Friedrich zu Stolberg-Wernigerode schenkte. Dieser vererbte es seinem zweitältesten Sohn Graf Ferdinand und dessen Nachkommen, die bis zur Enteignung und Vertreibung 1945 hier ihren Sitz hatten. - Wir gingen durch die sehr herunter gekommene kleine Straße, vorbei an ebensolchen Bewohnern, und sahen durch das Gittertor auf die Schlossfassade (links).
Zum Aufstand der Weber kam es vom 4. bis 6. Juni 1844. Mit ständigen Lohnkürzungen und Arbeitszeit-Verlängerungen hatten die Fabrikanten zuvor versucht, die Preise ihrer Leinen- und Baumwoll-Erzeugnisse niedrig zu halten. Damit wollten sie der britischen Konkurrenz begegnen. Jedoch führte dies zur Ausbeutung und Verelendung der Arbeiter. Gleichzeitig hatten die Hausweber Angst vor der Vernichtung ihrer Existenz durch das Aufstellen mechanischer Webstühle.
Ein Weber hatte angeblich "aufrührerische Lieder" auf einer Straße in Peterswaldau gesungen und wurde verhaftet. An die dreitausend Weber stürmten die Fabriken und zerstörten Maschinen und Geschäftsbücher. Preußische Truppen schlugen den Aufstand blutig nieder. Auch Gerhart Hauptmann nahm ein halbes Jahrhundert später das Thema auf in seinem Drama "Die Weber".

5.10 Langenbielau/Bielawa
Die Stadt Langenbielau mit heute 31.000 Einwohnern erstreckt sich entlang eines Flusses 55 Kilometer südwestlich von Breslau in 280 bis 345 Metern Höhe am Fuße des Eulengebirges unweit der tschechischen Grenze. Der Name des Ortes wird von seinem Bach abgeleitet, in dem das slawische Wort für die Farbe weiß enthalten ist (biela, bila, biala). Wie das benachbarte Peterswaldau wurde Langenbielau durch den Weberaufstand bekannt. 85
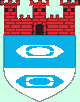
Der Ort wurde 1288 erstmals urkundlich genannt, aber bereits geraume Zeit zuvor muss es hier eine Siedlung gegeben haben. Im 16. Jh. entwickelte sich hier das Weberhandwerk sehr gut. 1598 wurde ein Schloss gebaut. Die Pest suchte 1713/14 den Ort heim. Im 18. Jh. entstand die erste Manufaktur. 1870 lebten hier rund 12.000 Menschen. Erst 1924 erhielt Langenbielau das Stadtrecht. 86
Größtes sakrales Bauwerk ist die neugotische Kirche Mariä Himmelfahrt. Vorgängerbauten bestanden schon seit der Stadtgründung. Der 1519 errichtete Turm wurde 1866 wegen Einsturzgefahr abgebaut. Der rote Backsteinbau wurde 1876 fertig. Der 101 Meter hoch aufragende neue Turm ist der dritthöchste Kirchturm im heutigen Polen. - In der Nähe der Kirche suchte ein älterer Mitreisender sein Geburtshaus. Er hatte eine alte Fotografie mit drei stattlichen dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern im Vordergrund der Kirche mit gebracht, allerdings im Hotel zurück gelassen. Einige neue Fotos wurden aufgenommen - allerdings scheint nur eines der drei Häuser nahezu unverändert geblieben zu sein, die beiden anderen (auch das angekreuzte Haus der Kindheit) wurden offenbar teilweise abgebrochen oder ganz durch Neubauten ersetzt.
5.11 Krummhübel/Karpacz
Die Stadt Krummhübel mit etwa 5.100 Einwohnern verfügt über 8.500 Gästebetten, denn sie wurde zum wichtigsten Zentrum des Tourismus im polnischen Riesengebirge. Das Stadtgebiet liegt auf einer Höhe zwischen 480 bis 885 Metern, die Stadtmitte auf 630 Metern.
Krummhübel wurde 1599 erstmals als Blei- und Eisenmine erwähnt. Vor gut einem Jahrhundert wurden nach dem Anschluss an das Eisenbahnnetz mehrere Metall verarbeitende Industriebetriebe angesiedelt. Die deutschen Bewohner wurden 1947 zum Verlassen ihres Ortes aufgefordert. 1960 erhielt Karpacz das Stadtrecht. 87 - Leider fiel während des Vormittages unserer Anfahrt heftiger Regen, so dass wir den Ort nicht durchwanderten.

5.12 Schmiedeberg/Kowary
Im Riesengebirge, auf 430 Metern Höhe, liegt Schmiedeberg, heute mit etwa 12.000 Einwohnern. Eisenerz wurde hier 1148 gefunden, zehn Jahre später wurde mit dessen Abbau auf Geheiß von Fürst Boleslaw Kedzierzawy begonnen. Die Siedlung entwickelte sich gut und wurde 1355 erstmalig urkundlich erwähnt. 1513 verlieh ihr der Böhmenkönig Vladislav II. das Stadtrecht.


Neben Breslau und Schweidnitz war Schmiedeberg eines der wichtigsten Zentren der Eisenindustrie in Niederschlesien im 16. Jh. Vor allem Feuerwaffen waren ein wichtiges Erzeugnis des ansässigen Handwerks. Der Dreißigjährige Krieg vernichtete große Teile der Stadt und brachte das Ende ihrer Blütezeit. Durch die Überschwemmung der Erzgrube kam der Bergbau zum Erliegen; es entwickelte sich das Weberhandwerk. Zaghafte Versuche im 18. und 19. Jh., den Bergbau wieder zu beleben, blieben ohne größeren Erfolg. Neben der Textilindustrie war der Uranerzabbau von 1948 - 72 von Bedeutung.
Im Stadtbild fällt die spätgotische Pfarrkirche St. Marien am Franziskanerplatz auf. Die barocke Steinbrücke trägt typisch böhmisch eine Statue des Hl. Nepomuk. An der sanft ansteigenden Haupteinkaufsstraße steht das klassizistische Rathaus, das von 1768 - 69 auch vom Baumeister Carl Gotthard Langhans erbaut wurde.
Die eigentliche Attraktion des heutigen Kowary ist jedoch der "Park Miniatur" im Gewerbegebiet auf dem Gelände der ehemaligen Teppichfabrik. Auf dem Grundstück wurden 24 Paläste, Kirchen, Klöster und Altstädte im Maßstab 1 : 25 nachgebaut, und zwar mit einer erstaunlichen Genauigkeit. 88 (Foto: Erklärer Adam vor dem Modell Fürstenstein)

Der Unternehmer Marian Piasecki hat sich hier seinen Lebenstraum verwirklicht. Bis vor sieben Jahren war er bei Siemens im Reaktorbau beschäftigt, wie er uns persönlich beim Empfang erzählte. Das Hirschberger Tal sei in Deutschland heute fast unbekannt. In Preußen hatte es einst die Bedeutung von Garmisch Partenkirchen im heutigen Deutschland bzw. Zakopane im modernen Polen. Da er gelernt habe, Projekte zu leiten, wollte er die Bekanntheit seiner Heimat verbessern.
Mit seinen gesparten 36.000 Euro kehrte er nach Kowary zurück. Hier hat er sich eine Halle gemietet und die besten Leute ausgesucht, die für ihn die Modelle gebaut haben - aus wetterfestem Hartschaum (links: Schloss Erdmannsdorf mit Reisegruppe). Die Idee zu einem Miniaturenpark kam ihm beim Besuch bei seiner Muter.


Ursprünglich dachte er daran, die Wahrzeichen großer europäischer Städte nachbauen zu lassen. Dann entschied er sich jedoch für die Bauten im Hirschberger Tal, die alle Baustile Europas zeigen. In 2006 kamen bereits 70.000 Besucher! - Uns führte flott der gut Deutsch sprechende Angestellte Adam, der nicht nur die Modelle erklärte, sondern ein erstaunliches Hintergrundwissen über das aktuelle Schicksal der Gebäude hat, vom dem ihm andere Besucher erzählt haben.
5.13 Weitere Städte
Die Hinfahrt führte von Norden nach Süden quer durch Berlin mit einer Rast am Schloss Charlottenburg. In Sachsen wurden die beiden Oberlausitzer Städte Bautzen und Görlitz auf der Hin- bzw. Rücktour für einen stadthistorischen Rundgang genutzt. Über Berlin (und Hamburg) mit Prof. Matthée sowie über die Oberlausitz mit ihren prächtigen Altstädten habe ich bereits in anderen Reiseberichten, auch mit Prof. Kiesow, geschrieben, daher wird hier auf weitere Ausführungen verzichtet.
6 Dank
Wem konnte ich im Bus auf der Rückreise um Berlin herum danken? Als erstes - Sie werden staunen - der Familie von Küsters, obwohl wir sie nicht angetroffen haben. In dem Dokumentarfilm "Schlesische Märchenschlösser", welchen ich schon drei oder vier Mal angesehen habe, wurde die Familie und ihr wieder gewonnenes "Paradies" von Lomnitz vorgestellt. Zu meinem so geborenen Wunsch, selbst dieses verwunschene Tal am Bober unter der Schneekoppe zu erkunden, kam die Gelegenheit, auf der Reise durch Norditalien am Po das Zimmer mit Prof. Matthée zu teilen. Scheinbar beiläufig fragte ich ihn, ob man nicht einmal über Himmelfahrt das Hirschberger Tal bereisen könnte? Er ganz spontan: "Oh ja, das machen wir!"
Aber für eine Gruppenreise brauchen wir genügend Teilnehmer, und hier geht der Dank an die Freie Lauenburgische Akademie unter Dr. Budesheim, welche die Exkursion in ihr Jahresprogramm 2007 aufgenommen und so dafür geworben hat. Es fanden sich auch 25 Mitreisende, welche diese Tour erst ermöglicht haben, weil sich die Reihen des alten Stammes an Reisegefährten des Prof. Matthée schon sehr stark gelichtet hatten. Doch noch zwei Tage vor der Abreise drohte der nächste Unbill: Auch der Busunternehmer hatte sich heimlich abgesetzt und es musste Ersatz gefunden werden - wozu die Firma Irro aus Dannenberg bereit war. Dem Fahrer Herrn Zühlke schließlich ist es gelungen, uns über deutsche und polnische Autobahnen, die fast ausschließlich sehr guten National- und Landstraßen in Polen, durch enge Altstädte, über schmale Brücken und bis ins Gebirge hinauf, sicher zu befördern und bei Hunger auch zu beköstigen. Das Hotel "Mercure" in Jelenia Góra hat einen guten ***Standard eingehalten, uns im lauten "Saal der Deutschen" gut gesättigt und mit Pivo, Wodka usw. getränkt (im unteren Bild: unterm Sonnenschirm vor dem Paulinum über Hirschberg). Die örtlichen Führer und neuen Besitzer haben uns oft mit Leidenschaft ihr Werk und damit das alte Vermächtnis aus deutscher Zeit nahe gebracht. Noch ausbaufähig ist das neue Schlesische Museum in Görlitz, das im "Schönhof" neben dem alten Rathaus vorzüglich untergebracht ist, jedoch unter einem Mangel an Exponaten und guten Pädagogen leidet. 89
So wurde meine 31. Reise mit Prof. Ulrich Matthée ein unvergessliches Erlebnis, worauf er sich - trotz seiner zehnwöchigen Indochina-Reise - kurz vorher mit einer Mountain-Bike-Tour (!) durch das Märchental vorbereitet hatte.
Text und Fotos: Manfred Maronde
zurück Übersicht
Bildnachweis
Alle Wappen: Internet: http://de.wikipedia.org
Landkarte Kriegsfolgen: Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Oder-Nei%C3%9Fe-Grenze
Porträt Gerhart Hauptmann: Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhart_Hauptmann
Grundriss und Zeichnung Schloss Boberstein: Internet: www.boberstein.com
Foto Schloss Lomnitz als Ruine: Internet: www.schloss-lomnitz.pl
Grundriss und Vertikalschnitt Barockkirche Liegnitz: Broschüre: Legnicke Pole, von Jan Wrabec, Legnica 1987

Arial CE;
Endnoten
1 Buch: Neues Großes Volkslexikon (NGV), Fackelverlag G. Bowitz GmbH Stuttgart 1979, Band 8, Seite 462
2 NGV, Band 8, Seite 463
3 Broschüre: Breslau wie es war, von Konrad Müller, Verlag Unser Weg Goslar 1949, Seite 17
4 Buch: Bilder aus Schlesien (BaS), von Wolfgang Schwarz, Edition Dörfler im Nebel Verlag GmbH Eggolsheim, mit 500 Schwarz-Weiß-Fotos vom Leben wie es damals war, Nachwort Seiten 207 ff.
5 Buch: Breslau - damals, von Inge Kowalsky, Laumann Verlag Dülmen 1991, Seite 40 über Pastor Johannes Blümel
6 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Oder
7 NGV, Band 8, Seite 186
8 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Schneekoppe
9 Zeitung: Mitteldeutsche Zeitung vom 18.06.2007
10 Buch: BaS, Seite 141
11 Buch: Historische Ansichten von Schlesien, von Heinz Csallner, Edition Dörfler im Nebel Verlag GmbH Eggolsheim 2004, mit 400 Schwarz-Weiß-Fotos, Vorwort Seite 7
12 Buch: Schlesien und die Schlesier, von Joachim Bahlke, Verlag Langen Müller München 2000, Seite 24
13 CD-ROM: Brockhaus digital 2002
14 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Schlesien
15 Buch: Deutschland - Porträt einer Nation, Bertelsmann Lexikothek Verlag Gütersloh 1985, Band 1, Seite 181 ff., Beitrag von Wolfgang Weismantel
16 CD-ROM: Brockhaus digital 2002
17 Buch: Historischer Atlas Deutschland, von Manfred Scheuch, Bechtermünz/Weltbild Verlag 2000, Seite 242 f.
18 Buch: GEO Themenlexikon (GEO), Gruner + Jahr 2007, Band 19, Seite 1093 f.
19 Buch: Geschichte Friedrichs des Großen (GFdG), von Franz Kugler mit Zeichnungen von Adolph von Menzel, Reprint-Verlag Leipzig, Seiten 216 ff.
20 Internet: www.abendblatt.de/daten/2006/08/29/603815.html?prx=1
21 GFdG, Seiten 351 ff.
22 GEO, Band 19, Seite 1113 f.
23 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Schlesischer_Krieg , http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Schlesischer_Krieg , http://de.wikipedia.org/wiki/Siebenj%C3%A4hriger_Krieg
24 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichisch_Schlesien
25 BaS, Seite 208
26 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Preu%C3%9Fisch_Schlesien
27 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Aufst%C3%A4nde_in_Oberschlesien
28 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Schlesien
29 Buch: Das Tal der Schlösser und Gärten - Das Hirschberger Tal in Schlesien - ein gemeinsames Kulturerbe (DTdSuG), von Prof. Dr. Olgierd Czerner, Wroclaw, und Prof. Dr. Arno Herzig, Hamburg, Gesellschaft für interregionalen Kulturaustausch e.V., Berlin, 3. Auflage 2003, ISBN 83-914131-0-1, Seiten 345 + 346
30 Internet: www.euroregion-neisse.de
31 Buch: DTdSuG, Seiten 379 - 381
32 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Mys%C5%82akowice
33 Tafel im Schloss Buchwald
34 Buch: DTdSuG, Seiten 331 - 334
35 Buch: DTdSuG, Seiten 359 - 362
36 was vom Enkel des Verwalters für unzutreffend erklärt wird
37 Buch: DTdSuG, Seiten 356 + 357
38 Internet: www.paulinum.pl auch in gutem Deutsch
39 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Agnetendorf
40 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhart_Hauptmann
41 Internet: www.gerhart-hauptmann.de Seite Geschichte
42 Buch: DTdSuG, Seite 378
43 Buch: DTdSuG, Seiten 407 + 408
44 Internet: www.boberstein.com in blumigem, etwas holprigem Deutsch
45 Buch: DTdSuG, Seiten 327 + 328
46 Fernsehfilm: Schlesische Märchenschlösser, von Hans-Dieter Rutsch, Havel-Film Babelsberg, RBB, 2003, zuletzt ausgestrahlt am 1. Mai 2007 um 14:30 Uhr vom HR
47 Buch: DTdSuG, Seiten 365 - 368
48 Internet: www.schloss-lomnitz.pl auf Deutsch und Polnisch
49 Buch: DTdSuG, Seiten 343 + 344
50 Buch: DTdSuG, Seiten 399 + 400
51 Internet: www.palacstaniszow.pl in brauchbarem Deutsch
52 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Kreisauer_Kreis
53 Faltblatt: Krzyzowa - Kreisau, Ehrenvorsitzende Freya von Moltke, USA, von 1990 und Internet: www.kreisau.de www.fvms.de
54 Broschüre: Kreisau - Krzyzowa: Ein Wegweiser durch Geschichte und Gegenwart, Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung und Internet: http://krzyzowa.org.pl
55 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Liegnitz
56 Broschüre: Wahlstatt - Eine Beschreibung und Führung, von Dr. Gotthard Münch, Reprint von 1941 aus Breslau
57 Broschüre: Legnicke Pole, von Jan Wrabec, übersetzt von Romuald Pawluk, Legnica 1987
58 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Kloster_Gr%C3%BCssau
59 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Kirche_Wang
60 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Lauban
61 Buch: DGiOE Schlesien, Seite 680
62 Internet: www.it.hsg.com.pl/de/content/blogcategory/24/37/ gut auf Deutsch verfasste Zeittafel
63 Fotobuch: Jelenia Góra - vom Tagesanbruch bis zur Dämmerung, von Cezary Wiklik, 2005
64 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Jelenia_G%C3%B3ra
65 Broschüre: Die Gnadenkirche "Zum Kreuz Christi" in Hirschberg, von Piotr Oszczanowski, Wydawnictwo MAK, Wroclaw 2005
66 Buch: Schatzkammer Deutschland (SD), Verlag Das Beste GmbH Stuttgart, 5. Auflage 1973/74, Seite 547
67 Internet: www.it.hsg.com.pl/de/content/blogcategory/26/39/ gut auf Deutsch verfasste Liste der Sehenswürdigkeiten
68 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Jauer
69 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenskirche_%28Jauer%29
70 Internet: www.wroclaw.de/p/3940
71 Buch: DGiOE Schlesien, Seite 677
72 Internet: www.stern.de/politik/historie/index.html?id=536507&nv=hp_rt Die Zahl der eingeschlossenen Zivilisten wird hier mit bis 250.000 angegeben.
73 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Breslau
74 Internet: www.wroclaw.de/p/3950 mit gut formulierten Informationen auf Deutsch
75 Broschüre: Breslau wie es war, von Konrad Müller, Verlag Unser Weg Goslar 1949, Seite 12, und Buch: SD, Seite 547
76 CD-ROM: Brockhaus digital 2002
77 Buch: Bilder aus Schlesien, von Wolfgang Schwarz, Edition Dörfler im Nebel Verlag GmbH Eggolsheim, Seite 25
78 Buch: SD, Seite 548
79 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82brzych und CD-ROM: Brockhaus digital 2002
80 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Schweidnitz
81 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Friedenskirche_%28Schweidnitz%29
82 Broschüre: Die Friedenskirche zu Schweidnitz, von Pfarrer Waldemar Pytel, Evangelische Kirchengemeinde Schweidnitz, Blätter zur Kulturarbeit Nr. 72, Bonn 1993
83 Internethttp://de.wikipedia.org/wiki/Peterswaldau
84 CD-ROM: Brockhaus digital 2002, schlesischer Weberaufstand
85 Internet: www.bielawa.pl auch mit gut lesbaren deutschen Seiten
86 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Langenbielau
87 Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Krummh%C3%BCbel
88 Flyer und Internet: www.park-miniatur.com
89 Internet: www.schlesisches-museum.de
zurück Übersicht