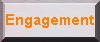
Leserbriefe: Meine Meinung in der Zeitung | |||||||
Zu den notorischen Leserbrief-Schreibern, die zu jedem möglichen Thema ihren "Mostrich" geben wollen, gehöre ich nicht. Nur wenn ein Bericht in der Zeitung steht, der so nicht unwidersprochen bleiben darf - weil er unrichtig oder einseitig ist - reagiere ich darauf. Aber dann ist es mir ein echtes Anliegen, andere Leser von meinem Standpunkt zu überzeugen. Am besten lesen Sie selbst: . | |||||||
Ja zur neuen Rechtschreibung Etwa einmal pro Woche lese ich in dieser Zeitung einen Leserbrief gegen die seit vier Jahren gültigen Rechtschreibregeln. Um es gleich vorweg zu sagen: Ich bin froh über die neuen Regeln und wende sie gern und von Anfang an stets an. An die Entstehungsgeschichte erinnere ich mit gut, als in den 80-er Jahren die damals (mit DDR) noch vier Länder die Arbeiten begannen. Bis Mitte 1997 nahm kaum jemand Notiz davon. Doch dann begann das Wehklagen, insbesondere aus Kreisen der Schriftsteller. Lassen Sie mich hier einige Fragen stellen und darauf Antworten geben. 1. Wem gehört die Sprache? Sie gehört allen, die sie benutzen, und zwar sowohl Schriftstellern, Dichtern, Journalisten, Lehrern, Schülern, Verwaltungsangestellten und -beamten, Kaufleuten, Informatikern und so weiter. Damit alle diese Menschen einander verstehen, brauchen wir einheitliche Regeln. So weit so gut. Doch wer schafft diese Regeln? Wessen Autorität akzeptieren wir? Eine zwischenstaatliche Kommission hat es hier naturgemäß sehr schwer, denn sie hat für uns Betroffene „kein Gesicht", was in der heutigen Medien-Gesellschaft sehr problematisch ist. 2. Wozu dient Schrift? Schrift soll Sprache sowohl aufbewahren als auch transportieren. Seit den Erfindungen von Schallplatte, Tonband und vor allem Telefon, Rundfunk und Fernsehen haben diese Bedeutungen deutlich verloren, kein Zweifel. Rechtschreibregeln sollten wegen der Zweckbestimmung „Schrift folgt Sprache" nicht überbetont werden. 3. Womit schreiben wir heute? Der weitaus größte Teil der Schrift wird heute über Tastaturen in Textverarbeitungssysteme eingegeben. Diese Systeme verfügen, rund 20 Jahre nach der weltweiten Verbreitung von Personal Computern, über automatische Rechtschreibkontrollen. Damit ist die Motivation bei den heutigen Schülern, selbst die Rechtschreibregeln zu lernen statt sie dem PC zu überlassen, schwierig geworden. 4. Wozu brauchen wir neue Regeln? Auch die PC-Textsysteme müssen erlernt werden, wozu Unterrichtszeit und „Speicherplatz im Kopf" gebraucht werden. Deshalb ist eine Verringerung der Zahl der Regeln und die Beseitigung von Ausnahmen sehr hilfreich. 5. Waren die alten Regeln eindeutig und schlüssig? Die Antwort - siehe MAZ vom 16.05.02 - muss eindeutig „nein" lauten. Auch vor hundert Jahren war der „Duden" ein Politikum. So mussten einige Wörter wegen des Einspruchs von Kaiser Wilhelm II. in der alten Schreibweise bleiben, z.B. mit th statt mit t. Was die alten Regeln als Ausnahme durchbrach, wurde kurzer Hand als neue Regel fest geschrieben. Damit entstanden etwa 250 Schreibvorschriften, die Ausnahmen von Ausnahmen von Ausnahmen ... regelten. Jetzt sind davon etwa 100 Regeln gestrichen worden, und das ist gut so. 6. Sind alle neuen Regeln gut? Gewiss gibt es einzelne Regeln, die hätten auch noch verbessert werden können, und noch weniger neue Regeln, die gegenüber den bisher geltenden Vorschriften eine Verschlechterung darstellen. Es besteht überhaupt kein Grund, wegen der Kritik an einzelnen Beispielen das gesamte Reformwerk abzulehnen. Eine Rückkehr zum veralteten Regelwerk wird es daher nicht geben. 7. Was macht es den Menschen so schwer umzulernen? Die meisten Menschen trennen sich ungern von erlerntem Wissen und lieb gewonnenen Gewohnheiten. Die in der Kindheit erworbenen Kenntnisse zum Teil als überholt, ja als ungültig, zu kennzeichnen, fällt uns schwer. Aber die Halbwertzeit des Wissens sinkt von Jahr zu Jahr, wir müssen uns dieser Herausforderung stellen. 8. Wann werden alle Menschen die neuen Regeln anwenden? Rund die Hälfte aller deutsch sprechenden Menschen schreibt schon nach den neuen Regeln, so die „Zwischenstaatliche Kommission für deutsche Rechtschreibung" am 17.08.2000 (im Internet: www.ids-mannheim.de). Aber das Alter spielt hier eine entscheidende Rolle. Von den 16- bis 29-Jährigen sind es schon 44 %, von den 60-Jährigen und Älteren erst 9 %, wie die Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach (im Internet: www.ifd-allensbach.de) ermittelt hat. Bis es alle tun werden, verstreichen noch Jahrzehnte, ohne Zweifel. Auch meine Oma schrieb, bis sie 1985 starb, in „deutscher Schrift". Je mehr der einzelne Mensch schreibt, desto eher wird er sich umstellen. So haben sich nahezu alle Verwaltungen und kaufmännischen Betriebe umgestellt, was nur minimale Schwierigkeiten mit sich gebracht hat. Viele Vordrucke und Computer-Programme mussten ohnehin erneuert werden, unter anderem wegen des Jahres 2000, der Euro-Währung u.s.w. 9. Wie steht die deutsche Sprache im Wettbewerb da? Verglichen mit der Weltsprache Englisch hat Deutsch einen schweren Stand, obwohl rund 100 Millionen Menschen Deutsch als Muttersprache gelernt haben. Wir müssen uns anstrengen, gerade in Ostmittel- und Osteuropa Deutsch wieder als erste Fremdsprache attraktiv zu machen. Gerade die slawischen Länder - und auch die Türkei - können bei der Durchsetzung deutscher Interessen in der Welt wertvolle Fürsprecher sein und werden. Und einfache Schreibregeln machen für junge Menschen anderer Völker die Entscheidung, Deutsch zu lernen, leichter (Sie kennen den Ausspruch „Deutsche Sprache, schwere Sprache"). 10. Was bringen künftige Reformen? Sprache und Schrift werden auch künftig einem stetigen Wandel unterliegen. Die Informationsgesellschaft von morgen muss immer mehr Inhalte in immer kürzerer Zeit aufnehmen und verstehen. Und die Welt wächst immer weiter zusammen. So ist die Frage nach einheitlichen Regeln im gesamten germanischen Sprachraum (mit Skandinavien, Holland) durchaus ein Thema. Diesen Ländern fällt es übrigens viel leichter, Fremdwörtern eine der Aussprache folgende Schreibweise zu geben, als uns. Die Zuordnung von Lauten zu Buchstaben kann international in Frage gestellt werden (s statt z und umgekehrt, sh statt sch, Bedarf von q, v und x ...), das h als Dehnlaut u.a. Was mir - wenn es in etwa 20 Jahren kommen sollte - schwer fallen würde, wäre die „gemäßigte Kleinschreibung", also Substantive klein, Namen und Satzanfänge jedoch groß. Dabei werde ich voraussichtlich nicht mitmachen, weil dies dem Ziel der schnellen Lesbarkeit zuwider laufen würde. Fazit: Die neuen einheitlichen Regeln sind durchweg gut gelungen und in sich schlüssig. Die Schreibweise einzelner Wörter oder Satzzeichen nach Ermessen in Originalsprache oder eingedeutschter Form entspricht unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung. Statt gegen die Schreibregeln anzugehen, ist es besser, die Sprache selbst vor Überfremdung zu schützen, indem deutsche Wörter bei gleicher Bedeutung Fremdwörtern vorgezogen werden. Und mein Rat: Vergessen Sie die abgeschafften 100 Regeln, lernen Sie nicht 100 neue hinzu. Denn 350 Regeln zu beherrschen, wird Ihnen kaum gelingen. (geschrieben am 9. Juni 2002 für die "Märkische Allgemeine", wegen Überlänge leider unveröffentlicht, erneut eingesandt an den "Ruppiner Anzeiger" am 11. August 2004, dort abgedruckt, weiterer Brief an die "Märkische Allgemeine" am 2. März 2006, wieder unveröffentlicht) Korrektur der Rechtschreibreform - ist sie sinnvoll? Der Beitrag in der "MAZ" vom 28.02.2006 zu den "neuen Vorschlägen", die ein "Expertengremium" unter Hans Zehetmair erarbeitet hat, veranlasst mich zu der folgenden Stellungnahme. Ziel der neuen Rechtschreibung sollte, als die damalige zwischenstaatliche Kommission vor zwei Jahrzehnten damit begann, eine einfachere Schreibweise sein. Im Ergebnis wurden von etwa 250 Regeln rund 100 abgeschafft. Dies ist lobenswert. Nachdem die Regeln vor fast einem Jahrzehnt verbindlich werden sollten, meldeten sich - viel zu spät - einzelne Kritiker zu Wort. Ihr Ziel war durchweg nicht eine "bessere" Reform, sondern jegliche Änderungen völlig zu verhindern. Einige Zeitungsverlage haben sie darin bestärkt, um im Wettbewerb Leser zu gewinnen. Daher ist es richtig, auf diese Kritiker nicht zu hören und die Reform wie geplant umzusetzen, was bis auf zwei auch alle Bundesländer getan haben. Die neuen Vorschläge zielen leider auf die Wiedereinführung alter Regeln ab - und zwar auf die kompliziertesten, die es gab. Verstehen Sie, was mit "Akzentmuster" gemeint sein soll? Es gibt nicht nur eine Tradition der deutschen Sprache zur Zusammenschreibung, diese ist zugleich ihr größter Schwachpunkt. Wir alle wissen, dass wir Wörter um so schneller lesen können, je kürzer sie sind. Und warum sollen Adjektiv bzw. Substantiv und Verb zusammen geschrieben werden? Dies führte doch zu einer regelrechten Verben-Explosion. Die meisten anderen europäischen Sprachen werden doch auch ohne diese Konstruktionen verstanden. Bei der Zeichensetzung soll nur wenig verändert werden. Zwischen zwei Hauptsätzen wenigstens ein Komma zu setzen, wenn schon nicht einen Punkt, halte ich für allemal angemessen. Wie bei der Getrennt- und Zusammenschreibung von Wörtern gilt auch bei Sätzen: Mehr Satzzeichen erleichtern die Lesbarkeit. Die Worttrennung am Zeilenende nach nur einem Buchstaben (z.B. bei a-ber, ü-ber, A-bend) wurde mir schon vor drei Jahrzehnten ausgetrieben, weil durch den Bindestrich schon ein unrationeller Mehraufwand an Zeit entsteht. Und die Höflichkeitsanrede bei "Du" groß zu schreiben, ist in Ordnung, denn "Sie" wird auch so geschrieben. Diese Kann-Regeln habe ich ohnehin nicht übernommen. Von den "neuen Vorschlägen" werde ich keinen in meine tägliche Schreibpraxis übernehmen. Ich wünsche mir, dass auch die Deutschlehrer in ihrer Mehrzahl einsehen, dass es nicht sinnvoll ist, diese neuen, alten Regeln ihren Schülern zu vermitteln. Diese Änderungen können ohnehin allenfalls von Gymnasiasten verstanden werden. Das Viertel- bis Halbjahr im Deutschunterricht, das hierfür verbraucht wird, kann viel sinnvoller in das Literaturstudium investiert werden, woran es eigentlich mangelt - in einer Zeit, wo das gesprochene das geschriebene Wort mehr und mehr verdrängt. Mein Appell an alle, die täglich schreiben: Vergessen Sie die abgeschafften 100 Regeln, lernen Sie nicht 100 neue hinzu. Denn 350 Regeln zu beherrschen, wird Ihnen kaum gelingen. | |||||||
Die Medien und das Grundgesetz Der letzte Satz gehört nicht nicht zum Thema. Von meiner Regionalzeitung habe ich etwas Anderes erwartet als Solidarisierung mit der BILD-Zeitung. Franz Müntefering nimmt lediglich ein im Grundgesetz verankertes Recht für sich und seine Mit-Abgeordneten in Anspruch (Artikel 103, Rechtliches Gehör). Es muss auch Politikern doch wohl noch erlaubt sein, wenn man angegriffen wird, sich zu verteidigen. Vor Jahren, als ich Wahlwerbung in einem Wohngebiet verteilte, traf ich auf eine Gruppe Handwerker, die beim Stichwort "Politik" meinten: "Alle in einen Sack stecken und drauf hauen, du triffst immer den Richtigen." So macht es auch die BILD-Zeitung. Aber wozu führt eine solche Presse? Nicht dazu, die eigennützig handelnden Personen aus der Politik zu entfernen und die braven Leute darin zu belassen. Nein, das Vertrauen in die gewählten Volksvertreter wird im Ganzen ausgehöhlt. Unsere Vorväter und -mütter haben sich die Demokratie schwer genug erkämpft. Jetzt aus Frust "die halbe Stunde für die Wahl sinnvoller zu nutzen", wie der Schreiber des Leserbriefes "Wem kann man noch glauben...", wäre der ganz falsche Weg. Die Alternativen zur Demokratie sind entweder Diktatur (überall in der Welt anzutreffen und immer ein Hort der Korruption und Selbstbedienung durch die Herrscher) oder Anarchie (jeder macht was er will und keiner was er darf oder soll). Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus (GG Art. 20 II). Dazu brauchen wir gewählte Volksvertreter. Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit (GG Art. 21 I). Die Regierung wird von der Opposition kontrolliert. Aber nicht von der Presse. Die Medien sind keine Organe unserer Verfassung. Sie werden auf der Basis von Artikel 5 "Meinungsfreiheit" für die Allgemeinheit tätig. Wer weiter liest, findet in Artikel 2, das diesem Freiheitsrecht Schranken gesetzt sind. Ich bin nicht bereit hinzunehmen, gewählte Volksvertreter durch Teile der Medien als "Schießbudenfiguren" missbrauchen zu lassen. Es ist Aufgabe der Medien, zu berichten, und dies nach gründlicher Recherche, und dabei bei der Wahrheit zu bleiben. Unbewiesene Verdächtigungen, gegen die sich die Betroffenen anscheinend nicht einmal wehren dürfen, schaden unserer Gesellschaft. (geschrieben am 7. August 2002 für die "Märkische Allgemeine", nicht veröffentlicht) | |||||||
Der "Palast der Republik" muss erhalten bleiben Nun haben sie also die Maske vom Gesicht gerissen: die Gegner des "Palastes der Republik". Nicht länger verstecken sie sich hinter den Befürwortern des Wiederaufbaues des hohenzollernschen Stadtschlosses. Egal, was auf der frei werden Fläche entsteht: das Ding muss weg. Und dabei ist Platz genug da. Muss wirklich für den Neubau eines bedeutenden Teils des Schlosses der Republikspalast weichen? Ich meine, nein. Mein Vorschlag ist: Lassen wir den Palast der Republik stehen, bauen wir die ausgelagerte Inneneinrichtung wieder in den Rohbau zurück. Und richten wir darin ein Museum für die Geschichte der DDR ein! In einem Abstand von etwa fünf Metern kann dann der Neubau des Teils des Stadtschlosses entstehen, der früher auf dem jetzt freien Gelände gestanden hat. Dieser wird groß genug sein, um dafür eine entsprechende Nutzung zu finden. Wir Deutsche müssen lernen, mit unserer Geschichte zu leben und dafür Denkmäler zu akzeptieren. Wo bleibt eigentlich - im Jahr 15 nach der Maueröffnung - das Denkmal für die Wiedervereinigung? Jedes andere Volk auf der Welt hätte längst eines! (geschrieben am 17., veröffentlicht am 19. November 2003 in der "Märkischen Allgemeinen") | |||||||
Es geht nur um die Umverteilung der Kaufkraft Müssen wir sonntags einkaufen? Dem Leitartikel vom Montag, 4. Dezember 2006, muss ich widersprechen, ebenso wie dem Kommentar von Antje Schroeder. Eine sorgfältige journalistische Recherche sieht anders aus. Gefragt wurden nur Verbandsfunktionäre und Manager großer Einkaufszentren. Die Kunden stürmen keineswegs "die Geschäfte", will heißen "alle Geschäfte". Die Lobbyisten, welche die Freigabe der Öffnungszeiten, sogar den Sonntagseinkauf, durchgesetzt haben, wollen etwas Anderes als die Freiheit, die dem Konsumenten weis gemacht wird. Der "Handelsverband" wird von den großen Einkaufszentren sowohl finanziell wie ideell dominiert. Diese in den letzten fünfzehn Jahren mit viel Kapital aus dem Boden gestampften, viele Tausend Quadratmeter großen, Zentren (neudeutsch "Center") sollen belebt werden - auf Kosten der Klein- und Mittelbetriebe vor allem in den Innenstädten des Umlandes. Es geht also um die Umverteilung der Kaufkraft. Damit sich auch aus den Randregionen Brandenburgs die lange Anfahrt in die Zentren Berlins lohnt, müssen diese lange geöffnet sein - logisch. Mehr Zeit zum Einkaufen bedeutet eben nicht mehr Geld zum Einkaufen. Die Zeche zahlen die historischen Innenstädte auch in Brandenburg und in den Berliner Randbezirken - dort wird sich das Ladensterben beschleunigt fortsetzen. Statt eines guten Branchen-Mixes, der seit Jahrhunderten die Innenstädte belebt hatte, füllen zunächst Spielotheken und Billigmärkte die Läden, bis sie ganz leer stehen. Und dann muss man in die Großstadt fahren, um höherwertige Konsumgüter zu erwerben, die nicht gerade als "Aktionsware" von den Discountern feil geboten werden. Wollen wir das? Will das die "Märkische Allgemeine"? Näher an der Wirklichkeit liegt da schon der Beitrag "Schleppender Anlauf" im "Ruppiner Tageblatt" auf Seite 15. Wenngleich auch hier viel zu wenige Händler zu Wort gekommen sind - eine Buchhändlerin, ein Schuh- und ein Spielwarengeschäft - entspricht die Stimmung dieses Artikels schon eher der persönlichen Wahrnehmung. Als ich am 1. Adventssonntag mittags - wegen eines Museumsbesuches - in Berlin Mitte war, kam mir das Zentrum nicht besonders belebt vor, und auch nicht die Bahnhöfe einschließlich des neuen Hauptbahnhofes. Apropos Bahnhöfe: An den Bahnstrecken von und nach Neuruppin bin ich an etlichen wirklich toten Bahnhöfen vorbei gefahren bzw. umgestiegen. Sind diese traurigen Bauwerke einer anderen Ära Vorboten für die historischen Altstädte in Deutschland? Fazit: Wir Konsumenten brauchen die langen Ladenöffnungszeiten nicht, schon gar nicht am Sonntag. Und wir brauchen auch die überdimensionierten Einkaufszentren nicht. (geschrieben am 4. Dezember 2006, veröffentlicht am 6. Dezember 2006 in der "Märkischen Allgemeinen", kursiver Text nicht abgedruckt) | |||||||
Zur Bildungspolitik: Nicht verstanden Zum Besuch von Klaus Ness in der Mitgliederversammlung Das vermeintlich alte Ideal der sozialdemokratischen Bildungspolitik bestand nie im "Berufsstudenten" oder gar "Bummelstudenten", der bis zum Alter von 30 Jahren die Universität besucht und am Studienort im "Hotel Mama" wohnt, sich ansonsten der Müßigkeit hingibt. Wie kommt Frau Gottwald denn darauf? Im Gegenteil. Schon immer war, ist und bleibt die Leitlinie in der Bildungspolitik der SPD die Chancengleichheit. Unabhängig von Status und Einkommen der Eltern soll begabten - nicht etwa allen - Schülern das gesamte Bildungssystem offen stehen. Jeder soll seine Fähigkeiten voll entwickeln können und den Bildungs- und Berufsabschluss erreichen, der ihm von seinen geistigen und körperlichen Möglichkeiten gegeben ist. Wer das Abitur erreicht hat und studiert, soll nicht durch finanzielle Not gezwungen sein, durch Arbeit neben dem Studium den akademischen Abschluss von Semester zu Semester verschieben zu müssen. Ziel ist also ein finanziell abgesichertes, zügiges Studium und ein früher Einstieg in die Berufskarriere. Etwas anderes als einen frühen Zugang zum Erwerbsleben hat sozialdemokratische Bildungspolitik nie gewollt - und wollen auch alle anderen demokratischen Parteien nicht. (geschrieben an die Märkische Allgemeine am 7. Februar 2007, nicht abgedruckt) | |||||||
Noch nicht zu spät für das Dresdner Elbtal Stoppt die "Waldschlösschen-Brücke"! Danke für die Artikel vom 23. und 26. Juni 2009 und für das schöne farbige Luftbild. Wie man sehen kann, sind in die Landschaft bereits Wunden geschlagen, aber diese können heilen. Auf dem anderen Foto ist das Wiederlager der Brücke zu sehen. Mein Vorschlag: sofort aufhören zu bauen und am Wiederlager eine Gedenktafel anbringen. Was darauf stehen soll? "Hier siegte 2009 im letzten Moment die Vernunft über engstirnige Politik und Behördenwillkür. Die "Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland appellierte auf ihrer Tagung noch rechtzeitig am 15. Juni 2009, "die Baumaßnahmen und die ... bevorstehende Streichung von der Welterbeliste abzuwenden. Der Vorsitzende der "Welterbestätten Deutschland e.V., Horst Wadehn, bedauerte ebenfalls im Internet (www.unesco-welterbe.de) "mit großer Bestürzung und Verärgerung die vermeidbare Streichung. Er spricht den Dresdnern sein Mitgefühl aus, die sich "leidenschaftlich, vehement, aufrichtig und überzeugend mit ihren Argumenten eingesetzt haben. Die erst seit einem Jahr amtierende Dresdner Oberbürgermeisterin, Helma Orosz (CDU), bedauerte die Aberkennung ebenso und setzte sich bis zuletzt für einen "Konsens, gemeint ist die Verschiebung der Aberkennung, ein, wie in ihrer Pressemitteilung im Internet (www.dresden.de) zu lesen ist. So einfach geht das aber nicht. Zwar hat sich im Februar 2005 eine Mehrheit der teilgenommenen Bürger für den "Verkehrszug Waldschlösschenbrücke entschieden. Als aber erkennbar wurde, dass die UNESCO ein solches Bauwerk für unvereinbar mit dem Welterbe halten würde, wurde ein zweiter Bürgerentscheid verlangt. Diesen hat die CDU-Mehrheit in Stadt Dresden und Land Sachsen zu verhindern verstanden. Die Bürger wurden 2005 schlicht getäuscht. Wer hat denn gewusst, dass der Brückenbogen 30 Meter hoch aufragen soll, wie ein 10-stöckiges Hochhaus? Wer glaubte, dass die Brücke für 65.000 Fahrzeuge pro Tag ausgelegt sein sollte? Und wer dachte, dass ein unauffälliger Tunnel auch nicht mehr als die veranschlagten 160 Mio. Euro kosten würde? (Dies steht bei den Brückengegnern unter www.welterbe-erhalten.de.) Aber es kommt noch schlimmer: Auch der Bauherr, die Stadtverwaltung Dresden, hat offenbar geahnt, was da kommen könnte, und die Entfernung zum Stadtzentrum mit fünf statt zwei Kilometern angegeben. Dies ist glatter Betrug der Öffentlichkeit in Stadt, Land und Welt! Die Leserbriefschreiberin vom 30. Juni vermutet die Auto-Lobby hinter diesem Coup. Ich vermute außerdem die Bau-Lobby dahinter. Wie wäre es mit der Idee, dreimal Geld zu verdienen (ich meine, einzunehmen)? Einmal für den Bau der Brücke, dann für deren Abriss und schließlich für den Bau des Tunnels - da klingelt die Kasse! Und sind die Planer "Eisenloffel + Sattler, Ingenieure - Kolb + Ripke, Architekten wirklich so von sich überzeugt, keine andere, verträglichere Variante vorzuschlagen? Wie ich aus einem persönlichen Gespräch mit dem Vorsitzenden der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Prof. Gottfried Kiesow, weiß, wollte man unbedingt eine Flussquerung ohne Pfeiler im Elbwasser. Ohne diese Bedingung wäre ein wesentlich unauffälligeres Bauwerk möglich gewesen. Aber hätten die Architekten sich damit in der Welt sehen lassen können? Also: Stopp mit den Brückenarbeiten, heraus aus der Schublade mit den fertigen Tunnelplänen, und in ein paar Jahren einen neuen Antrag bei der UNESCO stellen. Dann wird über die Baustelle Gras gewachsen sein - und die Dresdner, Sachsen und Deutschen dürfen wieder stolz sein, über ihre, wenn auch späte, Fähigkeit zur Einsicht in die Vernunft. Und die Planer einer Flussquerung im Oberen Mittelrheintal in Rheinland-Pfalz sollten dieses folgerichtige Durchgreifen der UNESCO als Warnung verstehen, wie sie die Kölner bereits verstanden haben, die das rechte Rheinufer nicht mit Hochhäusern zugestellt haben. (geschrieben am 7. Juli 2009 an die Märkische Alllgemeine, leider unveröffentlicht) | |||||||
GEO im neuen Gewand "Es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird, wenn es aber besser werden soll, muss es anders werden." Georg Christoph Lichtenberg, deutsche Physiker und Schriftsteller (1742 - 1799) Guten Tag Herr Kucklick, als GEO-Leser von Anfang an, also seit 39 Jahren, melde ich mich mit diesem Zitat, auch einem Motto von mir. Über den neuerlichen Gesichtswandel von GEO nach nicht einmal zwei Jahren bin ich verwundert. Kurzum: Für den Leser hat sich nichts gebessert. Für die Lobhudelei im Editorial des September-Heftes gibt es keinen Grund. Zur Schrift: Weiterhin werden Typen ohne und mit Serifen bunt gemischt, was der Schriftsatzkunst widerspricht (aber heute fast überall anzutreffen ist). Auch der Hang zu immer kleineren Schriftgraden wird nicht umgekehrt, obwohl die Leser immer älter und damit ihre Augen immer schwächer werden. Und auch die Unsitte, Texte in Bilder einzubetten, geht munter weiter, nimmt sogar zu. Zu den Bildern: Dass den Bildern mehr Raum gegeben wird, kann ich nicht finden. Damals, als GEO 1976 ins Leben gerufen wurde, war ja gerade das Gleichgewicht von Farbfoto und Text im Reportage-Magazin das Prinzip. Dieses hat wesentlich zum Erfolg von GEO beigetragen. Mir scheint jedoch der Text immer mehr ins Hintertreffen zu geraten, Texte werden kürzer und durch zwischen die Spalten gequetschte Zitate im Lesefluss gestört (auch dies seit rund 15 Jahren immer häufiger in Printmedien zu finden), in meinen Augen eine "modische Schrulle". Papier: Das billige raue Zeitungspapier, auf dem wieder verstärkt gedruckt wird, ist GEO schlicht nicht würdig. Es ist dicker, trägt mehr auf, und lässt das Magazin im Zeitschriftenregal dicker erscheinen, um die Kauflust zu befördern. Besser auf diesen Effekt verzichten. Rubriken: Die Abkehr von den Rubriken, welche dem Magazin Struktur gaben, ist ein Schritt in die falsche Richtung. Das grüne GEO scheint mir ohne solche Rubriken zu einer Art "Resterampe" zu verkommen, in dem Beiträge veröffentlicht werden, die in kein anderes der diversen Spezial-Magazine passen, vom Thema und von der Länge her. Ob das GEOSKOP nun 361° heißt oder wie auch immer - es sollte wieder am Heftende stehen und nicht die Reportagen in einen vorderen und hinteren Teil spalten. Das neue Inhaltsverzeichnis verwirrt durch den Widerspruch zwischen Bildtexten und Einleitungen. Umschlag: Die Rückkehr zum zentrierten Titel und breiten Rahmen gefällt mir dagegen gut. GEO bleibt damit - wie seine andersfarbigen Geschwister - unverwechselbar. Wenn ich Ihnen einen Rat geben dürfte: Kehren Sie besser zur bisherigen Form des GEO-Magazins zurück, dies war deutlich professioneller und angenehmer. Allerdings mache ich mir wenig Hoffnung auf solche Einsicht. GEO-Leser werde ich trotzdem bleiben. Antwort-Mail: Lieber Herr Maronde, herzlichen Dank für Ihren ausführlichen Leserbrief - und entschuldigen Sie bitte die späte Antwort, aber wie Sie sich vorstellen können, haben uns sehr viele Briefe erreicht, die ich alle persönlich zu beantworten versuche. Dass Ihnen viele unserer Neuerungen nicht gefallen, bedauere ich. Natürlich beinhaltet die Überarbeitung eines Heftes wie GEO immer Risiken, besonders bei so vielen langjährigen Abonnenten. Auch möglich, dass wir in den ersten Heften nach der Überarbeitung hier und da ein wenig über das Ziel hinausgeschossen sind, das mögen Sie als Experimentierlust verzeihen. Wir beruhigen das Heft inzwischen wieder ein wenig, das kommt sicherlich Ihrem Lesevergnügen entgegen. Das Papier von 361 Grad ist, auch wenn sie sich etwas anders anfühlt, von höchster Qualität (und wird etwa nicht, wie zuweilen befürchtet, vergilben. Dass es sich anders anfühlt, rauer, griffiger, ist wiederum gewollt - es soll im Heft einen Akzent setzen und auch den Fingern eine Abwechslung bieten. Wenn dies nicht gelingt, bedauere ich das sehr. Wir hören sehr unterschiedliche Reaktionen auf diese Neuerung, manche Leser schätzen sie sehr, andere, wie Sie, nicht. Bislang kann ich noch keine klare Tendenz erkennen bei den Leserwünschen - und wenn, dann eher in Richtung Freude über die Abwechslung -; aber ich verspreche Ihnen, wir sammeln weiter Lesermeinungen und werden uns, sollte sich die Waage neigen, jederzeit daran orientieren. Es freut mich, dass Ihnen der Rahmen auf dem Cover gefällt, er ist sicherlich das größte Experiment, das wir gewagt haben. Und noch mehr freut mich, dass Sie uns weiter gewogen bleiben. Ich hoffe sehr, dass Ihre Unzufriedenheit ausbalanciert wird durch die Freude am restlichen Heft, das wir weiterhin mit Hingabe erstellen und in der Hoffnung darauf, unsere Leser mit guten Inhalten, überraschenden Perspektiven und immer viele neuen Einsichten zu verwöhnen. Mit herzlichem Gruß, Christoph Kucklick Dr. Christoph Kucklick Chefredakteur (geschrieben am 6. Oktober 2015, nachgefasst am 3. Dezember 2015, Antwort-Mail erhalten am 6. Dezember 2015) | |||||||
Wann wurde Martin Luther geboren? Vorwort in "monumente" 1/2016 Guten Tag Frau Nathan, guten Tag Frau Dr. Schillig, als ich heute Morgen in der neuesten "monumente" Ihr Vorwort las, stutzte ich bei dem Satz über die Thüringische Landesausstellung: "Sie stimmt auf den 500. Geburtstag von Martin Luther im Jahr 2017 ein ...". Zuvor habe ich ein Sonderheft (Der Spiegel, Geschichte: Die Reformation) zu Ende gelesen, das ich mir für die Zugfahrt von Eisenach nach dem Besuch der Wartburg gekauft hatte. 1517, am 31. Oktober, war in der Tat ein denkwürdiger Tag. Aber wie hätte "Klein-Martin", geboren 1517, als Säugling so gut über Kirche und Papst Bescheid wissen, einen Text in fremder Sprache ausdenken, ihn aufschreiben, an der Kirchentür hochklettern und das Papier mit seinen kleinen Fäusten dort annageln können? Nun, so klein war Martin Luther nicht mehr, denn (laut Lexikon) war er bereits am 10. November 1483 in Eisleben auf die Welt gekommen. Es erstaunt mich als Inhaber eines kleinen Verlages doch, dass ein solcher Fauxpas in einem Heft der "monumente" durch alle Produktionsstufen laufen kann, ohne bemerkt zu werden. Dennoch werde ich diese Zeitschrift wie alle zuvor komplett durchlesen und wertschätzen. Antwort-Mail: Sehr geehrter Herr Maronde, vielen Dank für Ihre Mail! Sie haben natürlich vollkommen Recht, dass sich im Vorwort ein Fehler eingeschlichen hat und 2017 nicht Luthers 500. Geburtstag sein wird, sondern sich der Thesenanschlag in Wittenberg zum 500. Mal jährt. Wir waren sehr peinlich berührt, als wir den ersten Anruf eines irritierten Lesers erhielten, denn natürlich wissen wir, dass der Anschlag seiner Thesen gefeiert wird. Warum ich das so niedergeschrieben habe und niemand es korrigierte, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ich konnte selbst nicht glauben, was ich da geschrieben hatte. Es tut uns sehr leid, dass wir so "betriebsblind" waren. Es ist nun leider nicht rückgängig zu machen und mir bleibt - an alle - nur eine aufrichtige Entschuldigung. Mit freundlichen Grüßen Dr. Christiane Schillig Deutsche Stiftung Denkmalschutz Chefredakteurin Magazin Monumente Schlegelstraße 1 53113 Bonn (geschrieben am 29. Januar 2016, Antwort empfangen am 2. Februar 2016) | |||||||